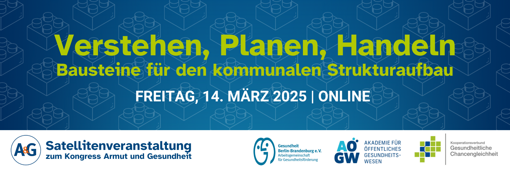
In den letzten Jahren konnte dank unterschiedlicher Fördermittel für den kommunalen Strukturaufbau einiges angeschoben, weitergeführt und ausgebaut werden, was lange Zeit ein Schattendasein führte. Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung und Gesundheitsförderung zählen zu den Bereichen, die eine erfreuliche Aufwertung erfahren haben. Doch der Auf- und Ausbau ist fragil. Angesichts auslaufender Förderungen stellt sich die Frage: Bleibt es bei dieser Initialzündung oder können wir den kommunalen Strukturaufbau in den nächsten Jahren weiter verstetigen?
In fünf verschiedenen Workshops und Diskussionsrunden tauschten sich über 300 Expert*innen aus Wissenschaft, Praxis und Politik zu den Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für eine strukturelle Verankerung von Gesundheitsförderung und Prävention aus.
Zentrale Erkenntnisse waren:
- Strukturelle Förderung statt kurzfristiger Projektfinanzierung: Um langfristige Gesundheitsförderung zu gewährleisten, sind nachhaltige Finanzierungsmodelle und gesetzlich verankerte Strukturen unerlässlich.
- Die Rolle der „Kümmerer“ vor Ort („Schnittstellen-Manager*innen“/„Netzwerk-Koordinator*innen“): Lokale Netzwerkarbeit und koordinierende Schnittstellen sind essenziell, um die Bedarfe der Bevölkerung zu erkennen und passende Maßnahmen umzusetzen.
- Partizipative Ansätze und politische Verankerung: Kommunale Gesundheitskonferenzen und interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken die kommunalen Netzwerke und erhöhen die Akzeptanz und Wirksamkeit der Maßnahmen.
- Evidenzbasierte Ansätze und Wirkungsmonitoring: Eine kontinuierliche Evaluation und der Transfer von Best Practices unterstützen die Verstetigung erfolgreicher Projekte.
- Tools: Digitale Tools unterstützen die Fachkräfte zunehmend in ihrer Planung und dem Monitoring von Angeboten und Strategien.
Den zentralen Nachbericht der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen lesen Sie hier.
Eingangsvortrag
Land und Kommune in Aktion: Wie kommen wir zu zukunftsfähigen ÖGD-Strukturen?
Dr. Monika Spannenkrebs, Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg
In ihrem Eingangsvortrag ging Dr. Monika Spannenkrebs der Frage nach: Wie kommen wir zu zukunftsfähigen Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)-Strukturen? Sie berichtete davon, dass die Kommunen im Zentrum der Förderung stehen sollten, da diese direkt in den Lebenswelten der Menschen aktiv werden können. Dazu gehören die Etablierung Kommunaler Gesundheitskonferenzen und die strukturelle Verankerung von Gesundheitsförderung und Prävention.
„Den ÖGD in einer neuen, pointierten Rolle etablieren: Der Pakt für den ÖGD ist eine wichtige Voraussetzung, um voranschreiten zu können.“ (Dr. Monika Spannenkrebs)
In Baden-Württemberg trügen hierzu maßgeblich neue, unbefristete Stellen bei, die unter anderem mithilfe des Pakts für den ÖGD geschaffen werden konnten. Durch diese zusätzlichen Stellen sei es möglich, wichtige Weichen für die Weiterentwicklung des ÖGD zu stellen. Spannenkrebs berichtete zudem von der bereits begonnenen Harmonisierung aller Fachanwendungen in den Gesundheitsämtern des Bundeslandes und von der Einrichtung einer Wissensdatenbank für alle ÖGD-Mitarbeitenden.
Als weiteres positives Beispiel – und als Beispiel für die Zusammenarbeit verschiedener Ministerien – nannte Spannenkrebs die Verschränkung der Einschulungsuntersuchung (ESU) mit dem Projekt SprachFit und die Zusammenarbeit mit dem baden-württembergischen Kultusministerium: Da die ESU in Baden-Württemberg im vorletzten Jahr vor der Regeleinschulung stattfindet, kann hier bei Bedarf frühzeitig vor Schuleintritt eine verbindliche Sprachförderung eingeleitet werden.
Fünf parallele Workshops
1. Effekte GKV-geförderter Projekte und Ansätze der partizipativen Wirkungsforschung in der kommunalen Gesundheitsförderung
- Prof. Dr. Dennis John & Sebastian Ottmann, Evangelische Hochschule Nürnberg
Moderation: Rajni Kerber, Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung – HAGE, Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit
- Präsentation
- Ankermodell für die Wirkungen von Präventionsketten, aus dem Programm Präventionsketten Hessen
- Zusammenfassende Mitschrift dieses Workshops
2. Herstellung von Transparenz innerhalb einer zu etablierenden Präventionskette: Wie kann man vorgehen?
- Dr. Manuela Schade, Gesundheitsamt Frankfurt/Main
Moderation: Barbara Gentges, Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen
3. Gesundheitsfolgenabschätzung in der Stadtentwicklung – Potenziale und praktische Anwendung
- Prof. Dr. Heidi Sinning & Christian Bojahr, ISP – Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation der Fachhochschule Erfurt, Arne Sibilis, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg
Moderation: Dr. Odile Mekel, Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit
- Präsentation
Die Zugangsdaten, die in der Präsentation angegeben sind, um sich das Tool anzusehen und es auszuprobieren, können Sie weiterhin gerne nutzen! - Zusammenfassende Mitschrift dieses Workshops
4. Daten, Umwege, Bedarfe und Bedürfnisse – wo liegen die Stolpersteine gelingender Gesundheitsförderung?
- Dorothea Wels & Melanie Glienke, Gesundheitsamt Leipzig
Moderation: Dr. Nicole Rosenkötter, Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen
5. Qualität und Prozesse in der kommunalen Gesundheitsförderung mithilfe von Tools stärken - Chancen und Grenzen für den Strukturaufbau
- Tools in der kommunalen Gesundheitsförderung Johanna Hovemann, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit
- Eine systematische Literaturrecherche zu Tools in der kommunalen Gesundheitsförderung Annegret Dreher, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit
- Der StadtRaumMonitor als ein Planungstool in der kommunalen Gesundheitsförderung Patricia Tollmann, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit
- Bewegungsförderung bei Kindern und Jugendlichen im kommunalen Setting fördern: Entwicklung eines Audit-Tools für Spielplätze & Schulhöfe Dr. Anna Streber, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit
Moderation: Christina Plantz, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit
- Präsentation
Die Handreichung „Planungstools für den Aufbau integrierter kommunaler Strategien in der Gesundheitsförderung“ lesen Sie hier. - Zusammenfassende Mitschrift dieses Workshops
Podiumsdiskussion
Bridge Over Troubled Water: Wie können kommunale Strukturen nun abgesichert werden?
- Dr. Katharina Böhm, Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung - HAGE
- Prof. Dr. Dennis John, Evangelische Hochschule Nürnberg
- Klaus Völkel, Stadt Witten und Gesunde Städte-Netzwerk
- Rebecca Zeljar, Verband der Ersatzkassen (vdek), Landesvertretung Berlin/Brandenburg
Moderation: Prof. Dr. Heike Köckler, Hochschule Bochum
Höhepunkt der Veranstaltung war die abschließende Podiumsdiskussion „Bridge Over Troubled Water: Wie können kommunale Strukturen nun abgesichert werden?“. Heike Köckler von der Hochschule Bochum, die die Diskussion moderierte, gab einleitend zu bedenken: „Der Wunsch nach weiteren Förderungen ist nicht die einzige Antwort.“ Basis der Statements, die von den verschiedenen Teilnehmenden der Diskussion vorgetragen wurden, war die grundsätzliche Forderung, aus der Projektlogik auszubrechen – also aus dem Hinarbeiten auf eine im Vorfeld definierte Auslaufzeit. Die Verstetigung sollte zu den Kernzielen gehören und die in den Projekten verfolgten Ziele von Beginn an zukunftsfähig gestaltet werden.
Networking, Lobbyarbeit und „Werbung“
Zentrale Wege, so die Diskutierenden, um eine Verstetigung der beispielsweise durch den ÖGD-Pakt ermöglichten Entwicklungen und Strukturen zu realisieren, seien Lobbyarbeit, persönliches Engagement und Networking. Neue Strukturen meint dabei: neu entwickelte Stellen zur Wahrnehmung womöglich ebenfalls neu definierter Aufgaben wie Gesundheitsplanung, Gesundheitskoordination, Gesundheitsberichterstattung (GBE) und Gesundheitsförderung/Prävention. Fallen diese Stellen durch das Ende einer Förderung wieder weg, können auch die entsprechenden Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden.
Die Teilnehmenden der Diskussionsrunde waren sich einig: Aussichtsreich für geschaffene Stellen und Strukturen werben kann man aber nur dann, wenn die Erfolge und Ergebnisse in den Projekten erfasst, entsprechend aufbereitet und für die Argumentation genutzt werden. Mittel für eine erfolgreiche Lobbyarbeit seien daher unter anderem eine solide Gesundheitsberichterstattung und eine grundsätzliche Wirkungsorientierung. Dabei ginge es nicht nur um die Frage, was erreicht wurde, sondern auch darum, was man mit den neuen Strukturen weiter erreichen will. Gerade in der Gesundheitsförderung und der Prävention könne ein etabliertes Wirkungsmonitoring die nötigen Argumente für eine politische wie gesellschaftlich gewünschte und unterstützte Verstetigung liefern. Für den ÖGD ist dies von zentraler Bedeutung, da Förderungen, mit denen diese Strukturen/Stellen zum Teil neu geschaffen wurden, wahrscheinlich auslaufen werden.
Abschließend wurde die Wichtigkeit der Partizipation betont: Durch die Zusammenarbeit und die Vernetzung mit den Bürger*innen und Akteur*innen vor Ort werden ÖGD-Strukturen nicht nur bekannter, sondern auch belastbarer. Kommunale Gesundheitskonferenzen können für die Bildung von Netzwerken und die kommunale Zusammenarbeit und Steuerung eine zentrale Rolle spielen.

